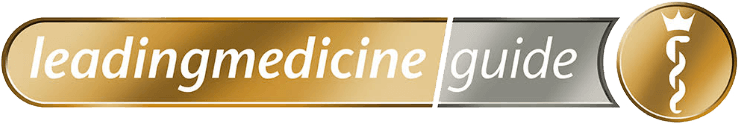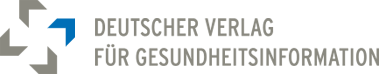Die Phoniatrie ist interdisziplinär angelegt und führt verschiedenste Berufsgruppen wie
- Ärzte,
- Phoniater,
- Logopäden,
- Pädaudiologen,
- Akustiker sowie
- Psychologen
zusammen. Der interdisziplinäre Austausch garantiert ein möglichst hohes Datenaufkommen. Die beteiligten Mediziner analysieren es aus unterschiedlichen Blickwinkeln, um die Ursachen der Störung ausfindig machen zu können.
Es besteht weiterhin eine enge Verbindung zu den Bereichen der
Im Jahre 1966 wurde die Arbeitsgemeinschaft deutschsprachiger Phoniater gegründet. Daraus ging später die Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie e. V. hervor. Trotzdem blieben Phoniatrie und Pädaudiologie bis 1978 ein unspezifiziertes Randgebiet der Medizin.
Ab 1978 wurden die Teilgebiete nach und nach in die HNO-Heilkunde eingegliedert und fungierten hier als Spezialdisziplinen. Auf Beschluss des Deutschen Ärztetages 1993 wurden die beiden Gebiete zu vollständig anerkannten Fachgebieten.
Mittlerweile können sich Mediziner durch eine fünfjährige Ausbildung zum Facharzt für Phoniatrie und Pädaudiologie weiterbilden.
Die meisten Sprachentwicklungsstörungen treten bereits im frühen Kindesalter auf. Dementsprechend beschäftigt sich die Phoniatrie vor allem mit den neurologischen Besonderheiten von frühkindlichen Hirnfunktionen.
Hierbei bemüht sich das Fachgebiet um eine frühzeitige Erkennung von Sprach- oder Schluckstörungen. In der Folge konzentriert sie sich auf deren Rehabilitation.
Aber auch im späteren Verlauf des Lebens können Kommunikationsbeschwerden auftreten, etwa als Folge eines psychischen Traumas. In Kooperation mit der Psychologie forscht die Phoniatrie hierbei nach den Ursachen der Sprachstörung.
Mittlerweile gibt es eine Reihe von Forschungsprojekten im Bereich der Phoniatrie. Dazu gehören unter anderem
- Experimente wie das Singen und das Spielen von Blasinstrumenten zur Erhebung artikulatorischer Funktionsbilder sowie
- Untersuchungen zur Zungenmotorik bei Verdacht auf eine neurologische Systemerkrankung.
Zu den Anwendungsgebieten der Phoniatrie zählen alle Fehlbildungen des Mund- und Rachenraumes, die artikulatorische Beschwerden und Schluckstörungen zur Folge haben.
Innerhalb der Phoniatrie wird zwischen verschiedenen Störungen unterschieden:
- Schluckstörungen und organische Fehlbildungen und
- Probleme bei der Artikulation in Sprech- und Sprachstörungen.
Viele Störungen sind das Produkt einer genetischen Veranlagung. Mögliche ererbte Störungen sind:
- Pierre-Robin-Syndrom
- Treacher-Collins-Syndrom
- Charge-Syndrom
- Down-Syndrom (Trisomie 21)
- Trisomie 13 und Trisomie 18
Sprachstörungen definieren sich durch eine neurologische Behinderung des Sprechapparates, zum Beispiel bei
- Sprachentwicklungsverzögerungen,
- beim Fehlen von synaptischen Verzweigungen oder
- bei selektivem Mutismus (Betroffene sprechen nur zu bestimmten Personen).
Beispiele für Sprachstörungen können sein:
- Komplikationen bei der Wortfindung
- Probleme bei der Unterscheidung von Lauten
- Syntaxfehler (Probleme bei der Formulierung grammatikalisch richtiger Sätze)
- semantische Fehlbezeichnungen (z. B. Wolke statt Himmel)
Unter Sprechstörungen werden hingegen Besonderheiten im Redefluss und in der linguistischen Performanz verstanden. Zu den Sprechstörungen wird weiterhin auch die Lähmung von Gesichtsnerven gezählt. Beispiele für Sprechstörungen sind:
- Stottern (lückenhafte Artikulation)
- Mutismus (Stummheit)
- Poltern (überhastete Artikulation)
- Dyslalie (Probleme bei der Artikulation von Lauten)
- Dysarthrie (unklare, genuschelte Aussprache)
- Dysglossie (hervorgerufen durch organische Veränderungen)

In der Phoniatrie sind auch Logopäden tätig © nellas | AdobeStock
Zusätzlich zu den aufgeführten Unterteilungen wird auch die Stimme im Einzelnen untersucht, um Veränderungen oder Anomalien aufzuzeichnen und in ein Gesamtbild einzufügen. Mögliche Ursachen von Dysphonien (Stimmstörungen):
- organische Fehlbildungen (Reflux, Stimmbandknötchen, Lähmungen)
- Polypen im HNO-Bereich
- Verätzungen und Verletzungen
- Infektionen der Atemwege
Zunächst einmal erheben Phoniater die Krankengeschichte des Patienten (Anamnese) und untersuchen die Symptomatik. Sie formulieren einen ersten Verdacht, den sie mit Hilfe von Zweitmeinungen anderer Berufsgruppen überprüfen.
Grundlegend bei Kommunikationsstörungen ist die Ursachenforschung. Rühren die Beschwerden von organischen oder neurologischen Ursachen her? Gibt es einen psychologischen Grund für die auftretenden Symptome? Oder sind sie unter Umständen das Resultat einer verschleppten Infektion?
Bei neurologischen Verfahren werden die Ströme und Areale des Gehirns kontrolliert. Unter Zuhilfenahme von diagnostischen Methoden wie
können Schäden oder Anomalien in der Hirnfunktion festgestellt werden.
Durch Tests wie Röntgen oder akustische Sprachtests wird die Funktion der beteiligten Organe überprüft.
Bei Schluckbeschwerden lassen sich minimal-invasive Untersuchungen durch die Nase und über den Mund durchführen. Fällt eine Diagnose dennoch schwer, liegt eine psychologische Ursache nahe. In diesem Fall werden Psychologen oder (Sprach-)Therapeuten eingeschaltet.
Die Anzahl möglicher Behandlungsmethoden ist so zahlreich wie das Spektrum der zu behandelnden Ursachen selbst.
Im Falle von Sprachentwicklungsstörungen, wie Behinderungen oder Verzögerungen, wird oftmals eine Sprachtherapie angewandt.
Kann diese Art der Therapie die Kommunikationsschwierigkeiten nicht beheben und sollten sich möglicherweise Verschärfungen der Problematik ergeben, ist oftmals eine Form der sogenannten Unterstützten Kommunikation angedacht. Sie kann mithilfe spezieller Geräte zu einer Verbesserung der kommunikativen Möglichkeiten beitragen.
Es gibt jedoch auch operative Verfahren in der Phoniatrie, wie zum Beispiel die Adenotomie. Diese routinemäßige Entfernung der Rachenmandeln wird in der Regel von einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt in die Wege geleitet. Auch Phoniater überweisen ihre Patienten in die Chirurgie, wenn sich eine organische Behinderung als Ursache für Schluck- und Sprechbeschwerden herausstellt.